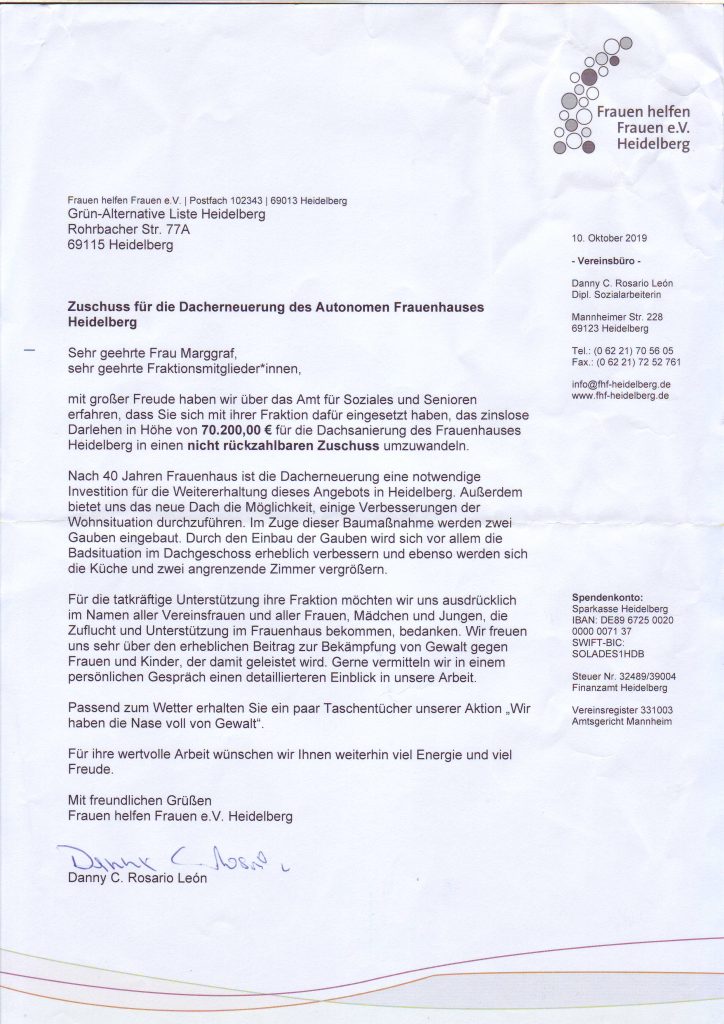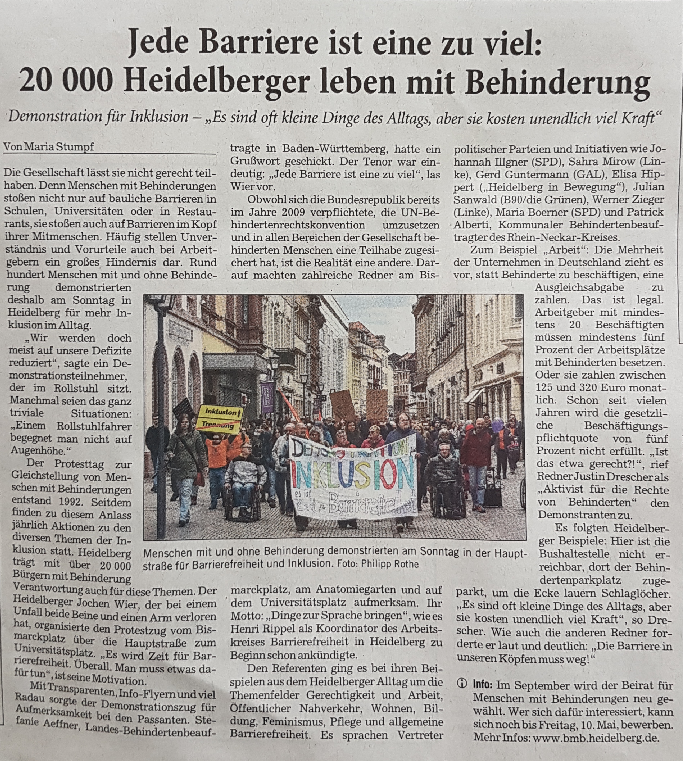Am 2.12.2017 fanden wir auf der Homepage der ‚Bunte Linke‘ einen Beitrag von Arnulf Weiler-Lorentz
„Mieterbeirat der GGH:
GAL und SPD offenbar bereit Element der Mitbestimmung aufzugeben
Dem Vernehmen nach wollen nicht nur die bürgerlichen Parteien der Abschaffung des Mieterbeirates der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz zustimmen, sondern auch die GAL und die SPD. Lediglich die Grünen, Die Linke/Piraten und die Bunte Linke halten an einem Mieterbeirat fest. In Bezug auf die GAL und SPD ist das schwer verständlich.
Es passt so gar nicht zu früheren Positionen und zur ihrer Geschichte. Die GAL, die den alternativen und basisdemokratischen Idealen der grün-alternativen Bewegung näher stand als die heutigen Grünen, ist leichten Herzens bereit, eine Form der Selbstorganisation und Mitbestimmung aufzugeben. Die SPD, die Partei der Arbeiterbewegung mit ihren Schutz- und Selbsthilfevereinen und Genossenschaften, die Partei die die betriebliche Mitbestimmung durchgesetzt hat, gibt diese Positionen hier ohne Not auf. Ich wünschte mir, dass diese Parteien zu ihren alten Standpunkten zurückkehren.“
Die hier formulierten Vorwürfe haben uns ’not amused‘, da sie undifferenziert und in Teilen sachlich falsch sind. Deshalb reagierte am 6.12.2017 unser Vorstandsmitglied Gerd Guntermann mit folgendem Schreiben:
Lieber Arnulf,
als GAL-Vorstandsmitglied wie GGH-Mieter muss ich Deinen „Stadtpolitik“-Kommentaren zum GGH-Mieterbeirat einiges entgegenhalten.
„Dem Vernehmen nach wollen GAL und SPD der Abschaffung des Mieterbeirats der GGH zustimmen…Die GAL ist leichten Herzens bereit, eine Form der Selbstorganisation und Mitbestimmung aufzugeben…“: Wer immer was auch immer vernommen hat, sollte vielleicht erstmal die Zuständigen (Fraktionäre) konsultieren, bevor er/sie so etwas behauptet – denn so undifferenziert verhält sich die GAL nicht.
Zur Sache: Leider haben sich zu wenig Kandidaten für den GGH-Mieterbeirat gemeldet. Dieser wird zwar von den Mietern gewählt, wurde aber vor vielen Jahren vom GR ins Leben gerufen, also nix von wegen Selbstorganisation.
In meinen bislang 7 Jahren als GGH-Mieter konnte ich feststellen: ein Mieterbeirat ist vielen GGH-Mietern unbekannt, viele stehen ihm gleichgültig gegenüber, die letzte Wahlteilnahme war sehr dürftig – und anderseits ist in der Vergangenheit der Beirat den Mietern nie durch resolutes Auftreten gegenüber der GGH aufgefallen. Er hat sich schlichtweg kaum bemerkbar gemacht. Ich bin vor einigen Monaten als stellvertretender Mieterbeirat, der eh nur über Protokolle informiert war, zurückgetreten: wo kaum was vertreten wird, gibt es auch nichts zu stellvertreten. Mein Eindruck war: ein GGH-Vertreter trägt irgendwelche Infos vor, und die Mieterbeiräte nicken es brav ab. Der Vertreter des Mieterbeirats im Aufsichtsrat scheint auch nie aufgefallen zu sein.
Alle 5 Jahre ein Aufruf von GGH (!)-Seite im „Domizil“ (dem GGH-Hausblättchen), für den Mieterbeirat zu kandidieren, eine Kurzdarstellung der Kandidaten: darauf beschränken sich die Erfahrungen der Mieter mit ihrem Beirat – so sie „Domizil“ überhaupt lesen.
Kurz und gut bzw. schlecht und bedauerlich: ein Großteil der Mieter ist desinteressiert an „Selbstorganisation“ und „Mitbestimmung“, und der Beirat hat sich nie bemüßigt gefühlt, das zu ändern – Themen gäb’s genug. Die „zahlreichen Widersprüche gegen die Vergabe der Treppenhausreinigung“, ein aktuelles Thema, beschränken sich leider auf wenige Dutzend Mieter, bei 7000 Mietwohnungen.
Das alles kommt natürlich der GGH entgegen, die sich nicht mehr um solches – aus ihrer Sicht – Gedöns kümmern mag, weil es ihren wirtschaftlichen Interessen entgegen steht: keine Zeit mehr für lästige Kommunikation und Auseinandersetzungen mit Mietern oder Beirat, die einem gewinnorientierten Unternehmen im Weg stehen.
Das Problem ist also keines, das von der GAL mitzuverantworten ist, sondern recht komplex.
„Bunten Linken“ und „Linken“ ist zuzustimmen, dass „eine Abschaffung des Mieterbeirats dem neoliberalen Zeitgeist entsprechen“ würde und die Mieter „durch einen demokratisch gewählten Mieterbeirat vertreten sein sollten.“ Nötigenfalls sollten die (zu wenigen) gewählten Kandidaten für größere Bezirke als bisher zuständig sein – und hoffentlich in Zukunft offensiver und motivierender für die Mieter auftreten. Lieber 3 Aktive als 10 Schlafmützen…
Als Alternative wäre ein Ombudsrat denkbar, von den Mietern zu wählen – aber ein Mieterbeirat ist zu präferieren.
Gruß,
Gerd
Am 8.12.2017 hat sich auch unsere Fraktionsvorsitzende Judith Marggraf, die auch Mitglied des Aufsichtsrates der GGH ist, an Herrn Weiler Lorentz gewandt:
Lieber Arnulf,
ich möchte dich herzlich, aber auch nachdrücklich bitten, deine Äußerungen zu o.g. Thema von deiner Website zu nehmen. Sie sind undifferenziert und sachlich falsch:
Richtig ist, dass ich als Mitglied des Aufsichtsrates der GGH dem Wechsel vom ‚System‘ der Mieterbeiräte zu einem ‚System‘ Ombudsleute zugestimmt habe. Der Aufsichtsrat hat zur Kenntnis genommen, dass die Mieterbeiräte in den vergangenen Jahren wenig aktiv waren und, dass sich für die turnusmäßigen Neuwahlen wenig bis (in einzelnen Bezirken) gar keine KandidatInnen gefunden haben. Dies ist sicher zu großen Teilen auch der Tatsache geschuldet, dass sich Mieter und Mieterinnen in Zeiten digitaler Kommunikationsmöglichkeiten häufiger direkt an die GGH wenden und nicht den „Umweg“ über einen Mieterbeirat wählen.
Insofern ist der Wechsel zu Ombudsleuten die Gewähr dafür, dass es nach wie vor AnsprechpartnerInnen gibt, die sich um die Belange kümmern, die nicht direkt mit der GGH besprochen oder geklärt werden können.
Zusammen mit der SPD habe ich mich erfolgreich dafür eingesetzt, dass auch für die Ombudsleute der § 5 der Satzung über die Mieterbeiräte erhalten bleibt. Dieser Paragraf sichert den Ombudsleuten die Möglichkeit, sich in strittigen Fragen an den Aufsichtsrat wenden zu können.
Ich habe auch die Position vertreten, dass die Ombudsleute aus ihrer Mitte einen Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden sollen. Diese Haltung fand im Gremium keine Mehrheit.
Den Vorwurf, „leichten Herzens…, eine Form der Selbstorganisation und Mitbestimmung aufzugeben“ weise ich entschieden zurück! Hätten die Mieterbeiräte sich in der Vergangenheit mehr selbst organisiert und wären mit relevanten Themen in Erscheinung getreten, hätte es vermutlich gar keine Überlegungen zu einem „Systemwechsel“ gegeben. Und, nicht zuletzt: Die Mieterbeiräte waren nie ein Mitbestimmungsgremium! Deshalb heißen sie auch -beirat und hatten einen Vertreter ohne Stimmrecht im Aufsichtsrat.
Lieber Arnulf, solltest du dich nicht dafür entscheiden, deinen Beitrag zu revidieren, bitte ich darum, meine Ausführungen als Gastkommentar auf deine Seite zu stellen.
Liebe Grüße
Judith
Darauf antwortete am 8.12.2017 Arnulf Weiler-Lorentz:
Liebe Judith,
ein Kommentar ist kein Bericht, sondern eine subjektive Meinung des Kommentierende. Subjektiv habe ich das so wahrgenommen, aus den
verschiedenen Informationen, die mir zugetragen worden sind. In der HAFA-Sitzung war keiner von Euch anwesend. Ich würde das wieder so
interpretieren, dass Euch die Abschaffung des Mieterbeirates nicht besonders wichtig ist.
Wenn Du gerne eine Erwiderung veröffentlicht haben möchtest, dann fasse sie bitte so ab, dass Du dabei nicht aus dem Aufsichtsrat und auch nicht aus der nicht-öffentlichen HAFA-Sitzung berichtest und keine nur dort verfügbaren Informationen benutzt. Selbst für das Abstimmungsverhalten der einzelnen Kollegen im HAFA bei der Abstimmung unseres Antrages hat der OB die Verschwiegenheitspflicht nicht aufgehoben. Ich hatte das beantragt und heute nochmals nachgefragt, da er sich Bedenkzeit erbeten hatte.
Mit besten Grüßen,
Arnulf Weiler-Lorentz
to whom it may concern: Judith Marggraf, als unsere Vertreterin im Haupt- und Finanzausschuss, hat an dieser Sitzung nicht teilgenommen, weil sie krank war und nicht, weil ihr das oder sonst ein Thema nicht wichtig erschien!