

Aus der Rhein-Neckar-Zeitung vom 24.02.24


Aus der Rhein-Neckar-Zeitung vom 24.02.24
Unser GAL-Bezirksbeirat Norbert Schön hat als aktives Mitglied des ADFC einen Leserbrief über die Bauplanung Dossenheimer Landstraße und der damit notwendigen, schnellen Einrichtung einer Fahrradstraße in der Steubenstraße geschrieben:
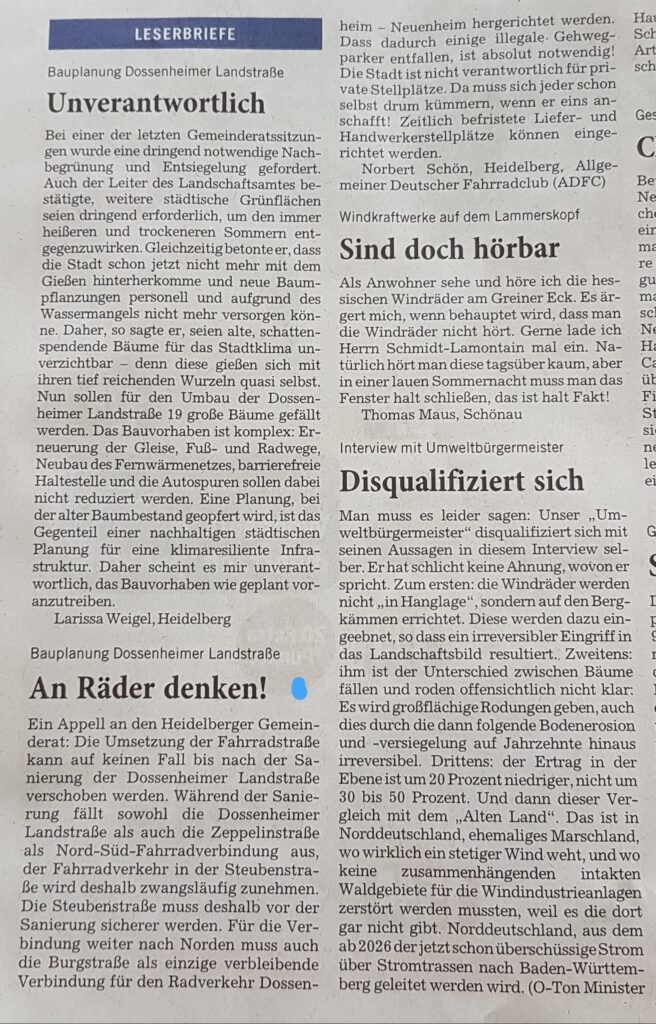
Begehung für Gemeinderäte angeboten
Im Handschuhsheimer Mühltal wurden im vergangenen Herbst und Winter Waldpflegearbeiten durchgeführt. Diesen war eine umfangreiche Information der Öffentlichkeit vorausgegangen, unter anderem mit einer Bürgerveranstaltung im Wald im September 2021. Die Waldpflegearbeiten im Mühltal waren Thema im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am 30. März 2022. Dr. Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamtes, und Tilmann Friederich, stellvertretender Amtsleiter und Leiter der Abteilung Forst, sowie der hinzugezogene Diplom-Forstwirt Volker Ziesling von der Bürgerinitiative „Waldwende Heidelberg“ erläuterten Fragen aus dem gemeinderätlichen Gremium. Diskutiert wurde unter anderem, warum Wälder in Zeiten des Klimawandels bewirtschaftet werden sollten und welche Rolle der Wald als natürliche Senke von Kohlendioxid spielt. Um sich ein eigenes Bild von der konkreten Situation im Mühltal zu machen, bot Dr. Ernst Baader den Mitgliedern des Ausschusses eine geführte Exkursion ins Mühltal an.
Presseinformation der Stadt Heidelberg
Am 30. März wird Volker Ziesling, Diplom-Forstwirt und Ansprechpartner der Greenpeace-Waldgruppe Mannheim-Heidelberg, beim Umwelt-Ausschuss Ihre Fragen zur Waldbewirtschaftung beantworten. Artensterben und Erderhitzung gefährden den Fortbestand der Menschheit auf unsererem Planeten und Wald ist einer der Schlüssel für die Lösung dieser beiden Probleme. Der Wald in Deutschland ist in den nächsten 20 bis 30 Jahren der effizienteste und billigste Zusatz-Kohlenstoffspeicher, den wir haben, und verschafft uns einen Zeitjoker, damit wir noch rechtzeitig auf Erneuerbare Energien umsteigen können. Die Stadt Heidelberg hat zu Recht den Klimanotstand ausgerufen, und dem müssen jetzt Taten folgen, auch in der Frage, wie der Heidelberger Stadtwald in Zukunft bewirtschaftet wird.
Unsere Betrachtung des Waldes als Gesamtökosytem orientiert sich unter anderem an den Thesen und Erfahrungen von Lutz Fähser (Lübecker Stadtwald) und Prof. Dr. Pierre Ibisch (Direktor Centre for Econics and Ecosystem Management an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung). Das Forstamt orientiert sich an der sogenannten multifunktionalen Forstwirtschaft, die jedoch in ihrem Kern zu sehr am ökonomischen Leitgedanken und auf Holzproduktion ausgerichtet ist.
Das Verständnis unserer Bürgerinitiative zu den Fällungen im Mühltalwald war es, dass in den beiden Nadelholzbeständen (i6, k6, i9) tatsächlich nur Nadelhölzer entnommen werden. Damit hatten wir uns einverstanden erklärt. Denn diese sind nicht standortgemäß und haben im Klimawandel schlechte Überlebenschancen. Damit war im Gegenzug klar war, dass keine Laubbäume gefällt werden sollten außer einige wenige, die der anzulegenden Seilbahntrasse im Weg seien.
Der Bestand h9 – anscheinend gleichzusetzen mit b9, was wir erst bei der erneuten Begehung mit dem Forstamt im Dezember erfuhren – wurde im Protokoll von Herrn Friederich vom 29.10.2021 ausgelassen (siehe „Ergebnisprotokoll_Waldbegang_2021-10-29„). Einen kleinen Eindruck vom jetzigen Zustand dieses Bereichs zeigt das Foto „Faellungen“. Auch die Karte der Durchforstungsmaßnahmen haben wir erst verspätet im November erhalten, als die Fällarbeiten bereits begonnen hatten (siehe „Karte_Durchforstungsmaßnahmen„).
Als wir die ab Ende November stattfindenden Fällungen verfolgten, mussten wir feststellen, dass diese nicht dem uns vom Forstamt vermittelten Eindruck entsprachen. Im Zuge dessen fand die erneute Begehung zur Klärung mit dem Forstamt am 10.12.2021 statt. Es kam jedoch zu keiner eindeutigen Klärung der Sachlage mit dem Forstamt, woraufhin wir uns entschieden, das von uns entwickelte Beteiligungsprojekt nicht mit dem Forstamt durchzuführen.
Die Bestände b7 und b10 sind tatsächlich nicht durchforstet worden und dies empfinden wir auch als positiv. Wir würden jedoch in unserer Glaubwürdigkeit gegenüber unseren Unterstützern einbüßen, wenn wir das Beteiligungsprojekt trotz der in viel größerem Maße stattgefundenen Durchforstungsmaßnahmen umsetzen würden.
Entgegen der Aussage in der Informationsvorlage zu den Waldpflegearbeiten im Mühltal entspricht es nicht der Wahrheit, dass Vertreter der Bürgerinitiative am Beteiligungsprojekt teilnehmen (siehe „Informationsvorlage_Waldarbeiten_Muehltal„). Bei den damit gemeinten Leuten handelt es sich um Teilnehmer an den Waldbegehungen, die vollkommen unabhängig von der Bürgerinitiative sind.
Die Bürgerinitiative hat eine Pressemitteilung zu ihrem erklärten Verzicht auf das Beteiligungsprojekt verfasst, die am 26.01.2022 auf der Website (www.waldwende-heidelberg.de) veröffentlicht wurde und auch an die regionale Presse geschickt wurde (siehe „PM_Buergerbeteiligungsprojekt„).
Zu der Beschlussvorlage zum Forstwirtschaftsplan 2022 wollen wir nur kurz auf Produktbereich 1 „Waldpflege, Holznutzung, CO2-Bindung“ eingehen:
Die Mehrheit der Holzprodukte verlängert die Kohlenstoffspeicherung keineswegs. Durch Transport und Verarbeitung wird CO2 frei, zudem sind die wenigsten Holzprodukte nachhaltig. Ein Großteil wird zu Papier, Verpackungsmaterial und Zellstoff verarbeitet, der nach wenigen Wochen dem Müll zugeführt wird. Ein anderer Teil wird als Brennholz genutzt, nur ein geringer Teil geht in die Möbel- und Bauholzindustrie. Dabei ist ferner zu bedenken, dass selbst Möbel in heutigen Zeiten keine lange Nutzungsdauer mehr haben.
Situationsabhängig ist die Substition von anderen Werkstoffen mit Holzprodukten natürlich vorzuziehen. Es ist jedoch falsch, dies als Klimaschutzaspekt darzustellen, wenn wir auf intakte Wälder im Zuge des Klimawandels in der wärmsten Region Deutschlands zählen müssen. Das Werkstoffproblem kann nicht von der Forstwirtschaft allein gelöst werden, sondern nur, wenn alle beteiligten Wirtschaftsbereiche an einem Strang ziehen.
Zugebenermaßen eine Mammutaufgabe für den Gemeinderat, aber genau dieses interdisziplinäre Denken und Handeln erwarte ich von den politischen Vertretern der Stadt, wenn wir auch noch in Zukunft auf diesem Planeten existieren wollen.
Falls Sie am Umweltausschuss teilnehmen, wäre es gut, wenn Sie sich vorher Fragen an Herrn Ziesling überlegen würden. Hier ein paar Vorschläge:
* Wie können wir die Kohlenstoffspeicherung im Wald erhöhen?
* Warum wird der Heidelberger Stadtwald nicht nach „Naturland“ zertifiziert?
* Was muss getan werden, um die Biodiversität im Wald zu verbessern?
* Stimmt es, dass im Amazonas, in rumänischen Urwäldern und anderswo mehr Wald vernichtet wird, wenn wir im Heidelberger Stadtwald weniger Bäume fällen?
* Welche Funktion hat der Wald im Wasserhaushalt?
* Haben Buchen überhaupt noch eine Chance im Klimawandel?
* Muss Wald wirklich „gepflegt“ werden, um klimaresilient zu werden?
* Ist es klimafreundlich, Holz als Kohlenstoffspeicher zu betrachten?
Ihnen fallen sicher noch mehr Fragen ein!
Aktionsbündnis Waldwende Heidelberg
Der Gemeinderat beendet den Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld und beschließt eine Nachverdichtung des Campus.
Von Holger Buchwald

Das Neuenheimer Feld von oben: Das Areal im Neckarbogen soll stark nachverdichtet werden, der grüne Streifen am Fluss bleibt aber erhalten. Ein Straßenbahnring soll das Gebiet verkehrlich entlasten. Foto: Kay Sommer
Heidelberg. Die Weichen für das Neuenheimer Feld sind gestellt. Nach einer lebhaften, zweistündigen Debatte und einem fast einstündigen Abstimmungschaos hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen, den Masterplanprozess zu beenden. Das Stadtplanungsamt hat nun die Aufgabe, aus den Entwürfen der Planungsteams von Astoc und Kerstin Höger eine Synthese zu bilden und somit einen Masterplan zu entwerfen.
Wichtigster Kernpunkt ist die Nachverdichtung des Campus, um den zusätzlichen Flächenbedarf der dort ansässigen Einrichtungen und Kliniken von 868.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche unterzubringen. Fest steht auch, dass ein kleiner Straßenbahnring durch die Straße „Im Neuenheimer Feld“ gebaut wird und der Autoverkehr in den Norden des Campus verlagert wird. Die neue Straße soll dann auf Höhe des Technologieparks in die Berliner Straße münden.
Bis zuletzt hatten die unterschiedlichen Interessengruppen noch versucht, ihre Positionen durchzusetzen. Ein besonderer Streitpunkt war dabei das Gewann Hühnerstein im Handschuhsheimer Feld, für das die Universität seit Jahrzehnten Baurecht hat. Rektor Bernhard Eitel wies in einer Sitzungsunterbrechung nochmal auf die Rahmenvereinbarung von Uni und Stadt hin. Die Wissenschaft könne langfristig auf dieses Baurecht nicht verzichten. Bereits im Vorfeld der Sitzung hatte Eitel damit gedroht, aus dem Masterplanprozess auszusteigen. „Den Hühnerstein brauchen wir“, sagte Eitel nun auch per Video-Schalte: „Wir reichen Ihnen die Hand, bitte schlagen Sie sie jetzt nicht aus.“
Während der Stadtentwicklungsausschuss noch beschlossen hatte, dass der Hühnerstein bis 2050 nicht bebaut werden darf, milderten die Mehrheitsfraktionen von Grünen, SPD, Linke, GAL und Bunte Linke dies in einem neuen gemeinsamen Antrag ab. Jetzt heißt es nur noch, dass er langfristig als Bauflächenreserve erhalten bleibt, aber möglichst bis 2050 nicht bebaut werden soll. Diese Formulierung fand gegen die Stimmen des bürgerlichen Lagers von CDU, „Heidelberger“ und FDP eine klare Mehrheit von 26 zu 16 Stimmen.
Deutlich kontroverser ging es beim Thema der verkehrlichen Erschließung zu. CDU, „Heidelberger“ und FDP forderten, dass eine Westanbindung des Neuenheimer Feldes, also jede möglichen Variante einer Neckarquerung von Wieblingen in den Campus ergebnisoffen geprüft werden solle. „Wenn eine Seilbahn diskutiert wird, sollte das auch für eine Brücke gelten, über die Rettungswagen zu den Kliniken fahren können“, forderte die Fraktionschefin der „Heidelberger“, Larissa Winter-Horn. Die besten Ergebnisse hinsichtlich einer Reduzierung des Autoverkehrs erziele eine Brücke für den Umweltverbund, die also auch von Straßenbahnen oder Bussen genutzt werden könne. Ähnlich sah dies Ingo Autenrieth, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums. „Wir brauchen dringend eine Westerschließung, durch die uns die Mitarbeiter, vor allem aber die Notfallpatienten gut erreichen können“, sagte er. Vor dem Hintergrund des Wachstums der Kliniken sei die aktuelle Situation nicht tragbar.
Große Verwirrung herrschte unter den Stadträten, als Oberbürgermeister Eckart Würzner diesen Unterpunkt zur Abstimmung stellte. Auf einmal hatte die Prüfung sämtlicher möglicher Westerschließungen, inklusive massiver Straßenbahnbrücke, eine Mehrheit von 18 zu 17 Stimmen. Einige Stadträte, die digital zur Sitzung zugeschaltet waren, hatten nicht mitgestimmt. Lautstark forderten daraufhin die Grünen Derek Cofie-Nunoo und Christoph Rothfuß eine Wiederholung der Abstimmung – nicht allen sei klar gewesen, worüber überhaupt abgestimmt werde. Hintergrund: Die große Brücke würde über das Naturschutzgebiet des Wieblinger Altneckars führen und wird daher von den Bewohnern des Stadtteils und den Umweltverbänden abgelehnt – und eigentlich sind auch die Grünen gegen eine Straßenbahnbrücke.
CDU-Fraktionschef Jan Gradel sprach sich gegen eine Wiederholung der Abstimmung aus und warf den Grünen ein bewusstes Manöver vor: Sie setzten Abweichler in der eigenen Fraktion „massiv“ unter Druck. Auch Würzner wollte es zunächst beim ersten Ergebnis belassen, während Cofie-Nunoo erbost gegen Gradels Unterstellungen protestierte. Erst nach einer längeren Sitzungsunterbrechung und Einschaltung des städtischen Rechtsamts wurde die Abstimmung wiederholt. Während der Unterbrechung zeigte die Videoübertragung aus dem Rathaus, wie Mitglieder aller Fraktionen aufgesprungen waren, Würzner umringten und auf ihn einredeten.
Grüne, SPD, GAL, Linke und „Bunte Linke“ simmten am Ende doch noch für ihren eigenen Antrag. Danach sollen die Reduzierung der Autostellplätze, die Einführung kostendeckender Parkgebühren und eine standortunabhängige Fuß- und Radbrücke über den Neckar ebenso geprüft werden wie eine Seil- oder Otto-Hochbahn, aber keine Straßenbahnbrücke. Am Ende gab es 25 Ja- und 15 Nein-Stimmen und eine Enthaltung von Julian Sanwald (Grüne). Adrian Rehberger (SPD) blieb aus Protest gegen das vorangegangene Chaos der Abstimmung fern.
Das Stadtplanungsamt hat nun die Aufgabe, im Neuenheimer Feld zunächst den Bebauungsplan für den Straßenbahn-Ring in Angriff zu nehmen. Auch dieser Antrag von Grünen und SPD fand mit 27 zu 15 eine deutliche Mehrheit.
Rhein-Neckar-Zeitung 31.01.2022:

Rhein-Neckar-Zeitung 03.02.2022:

Rhein-Neckar-Zeitung 20.01.2022

Jörg Schmidt-Rohr vom Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung und GAL Mitglied eröffnete die Aktionswoche gegen Armut und Ausgrenzung im Bürgerzentrum Südstadt, in der Chapel:
Rhein-Neckar-Zeitiung 19.10.2021:

Rhein-Neckar-Zeitung 15.10.2021:

Die Presseinformation der Stadt Heidelberg vom 18.10.2021:
Bautätigkeitsbericht 2020: Wachstum im Bestand mit 544 neuen Wohnungen fortgesetzt
Stadt Heidelberg auf Rang zwei bei Schaffung von Wohnraum im Vergleich mit Stadtkreisen des Landes
Heidelberg wächst weiter: Der Wohnungsbestand hat sich erstmals auf über 78.000 Einheiten erhöht. Insgesamt sind im Vorjahr 544 neue Wohnungen entstanden, 508 im Neubau in vielfältigen Größen für verschiedene Lebenslagen. 85 Wohnungen kamen durch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen hinzu, doppelt so viele wie 2019 – eine Folge konsequenter Innenverdichtung. Durch Abbrüche gingen 49 Wohnungen verloren. Das belegt der neue Bautätigkeitsbericht, der am Dienstag, 19. Oktober 2021, im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss vorgestellt wird.
Das Besondere am Wohnungswachstum in Heidelberg: Neue Wohnungen können direkt im Stadtgebiet geschaffen werden, da die Stadt aufgrund der Konversionsflächen über ausreichend Raum im Inneren verfügt. Mit 544 Wohnungen liegt das Wachstum konstant auf dem Niveau der Vorjahre (2019: 547 neue Wohnungen, 2018: 535 neue Wohnungen). Vergleicht man die Entwicklung des Wohnungsbestandes der neun baden-württembergischen Stadtkreise von 2010 bis 2020 liegt Heidelberg mit einem Anstieg von 7,2 Prozent auf Rang 2. Lediglich die Stadt Heilbronn schneidet mit einem Anstieg um 7,8 Prozent besser ab.
„Heidelberg ist ein deutschlandweit beliebter Wohn- und Arbeitsort. Zwischen 2019 und 2035 erwarten wir einen Bevölkerungsanstieg von knapp 25.000 Menschen. Wohnraum ist und bleibt also stark gefragt, knapp und ist daher oft teuer. Als Stadt ist es eine unserer wichtigsten Aufgaben, hier gegenzusteuern. Wir brauchen vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum für Familien, Studierende, Senioren. Über die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH (GGH) hat die Stadt selbst rund 150 Neubau-Wohnungen geschaffen, das sind knapp 30 Prozent aller neu gebauten Wohnungen im Jahr 2020“, sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.
Neubauten: Baubeginn oder Realisierung einiger Projekte verzögert
Das im Handlungsprogramm Wohnen festgehaltene Ziel der Schaffung von durchschnittlich 800 Wohnungen pro Jahr wurde auch 2020 nicht erreicht. Der in der Zielsetzung verankerte Wohnraum wird dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen, allerdings später als ursprünglich absehbar. Gründe dafür sind unter anderem der verzögerte Baubeginn einiger geplanter Projekte privater Bauträger in der Bahnstadt und Südstadt sowie spätere Fertigstellungen, etwa auf dem Hospital-Areal und in Patrick-Henry-Village. Das 2017 erstellte Handlungsprogramm Wohnen hatte dort für 2020 erste Fertigstellungen eingeplant. Beide Projekte werden nun erst später realisiert. Die Stadt arbeitet derzeit an der Fortschreibung des Baulandprogramms für den Zeitraum 2022 bis 2026, die diese Verschiebungen berücksichtigt.
Baugenehmigungen: Südstadt erstmals an der Spitze
Auch die Zahl der Baugenehmigungen ist seit 2017 erstmals wieder rückläufig: 2020 wurden 544 neue Wohnungen genehmigt. Das entspricht einem Rückgang von 26,4 Prozent gegenüber 2019. Die meisten Wohnungen wurden in den Stadtteilen Südstadt (254), Ziegelhausen (68), Pfaffengrund (35) und Wieblingen (34) genehmigt. In der Südstadt befinden sich knapp die Hälfte aller genehmigten Bauten, womit sie die Bahnstadt erstmals ablöst – ein Zeichen für die fortgeschrittene Entwicklung der Konversionsflächen.
Wichtiger Meilenstein für Klimaneutralität: Fernwärme für Neubauten
Heidelberg setzt sich für den Umweltschutz ein und möchte bis 2050 klimaneutral sein. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Dekarbonisierung der Heizenergie. Fernwärme wird heute zu etwa 50 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen und dieser Anteil soll zukünftig noch erhöht werden. 84,6 Prozent der Neubauwohnungen in Heidelberg werden bereits mit Fernwärme versorgt und nehmen daher an der Reduzierung des CO2-Ausstoßes teil.
Wohnraum in Heidelberg
• Ende 2020 gibt es 78.090 Wohnungen in Heidelberg.
• 51,5 Prozent beinhalten drei oder vier Zimmer und bieten unter anderem Raum für Familien.
• 7,2 Prozent des Heidelberger Wohnraums werden gefördert.
• Von 508 Neubauwohnungen liegen 259 Wohnungen (51 Prozent) in der Bahnstadt. Der Passivhaus-Stadtteil ist damit weiter der Wohnungslieferant für Heidelberg und belegt zum vierten Mal in Folge den ersten Rang unter allen Stadtteilen.
• Weitere 110 Wohnungen (21,7 Prozent) kamen im Stadtteil Kirchheim hinzu. Hiervon entstanden alleine 86 Wohnungen im Bereich des Höllensteins. 45 Wohnungen (8,9 Prozent) wurden im Stadtteil Rohrbach erbaut. 25 Wohnungen davon sind in der Karlsruher Straße hinzugekommen. Weitere 15 Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen sind im Bereich Kolbenzeil entstanden. Für den Pfaffengrund ist ein Zugang von 35 Wohnungen (6,7 Prozent) zu verzeichnen. Diese Wohnungen sind ausnahmslos im Kranichweg entstanden.
Bauüberhang bleibt auf konstantem Niveau
• Mit 1.624 genehmigten Wohnungen bewegt sich der Bauüberhang gegenüber 2019 auf einem konstanten Niveau.
• Die Konversionsflächen tragen in den kommenden Jahren massiv zur Schaffung von neuem und bezahlbarem Wohnraum bei.
• Rund ein Drittel des gesamten Bauüberhangs befindet sich auf den Konversionsflächen in der Südstadt (560 Wohnungen), die damit erstmals die Spitzenposition übernimmt.
• An zweiter Stelle steht der Stadtteil Rohrbach mit 242 Wohnungen. Hiervon entstehen 119 Wohnungen in einem Studentenwohnheim im Stadtviertel Rohrbach-West.
• Die Bahnstadt folgt mit 207 Wohnungen.
• Als Bauüberhang werden diejenigen Bauten bezeichnet, die in den zurückliegenden Jahren zwar genehmigt, bis zum Jahresende aber nicht fertiggestellt wurden.
Über den Bautätigkeitsbericht
Der jährlich erstellte Bautätigkeitsbericht analysiert detailliert Strukturen und Entwicklung des Wohnungsmarktes. Im Blick sind Baugenehmigungen, Baufertigstellungen durch Neubaumaßnahmen, Umbau und Sanierungsmaßnahmen sowie Abbrüche. Die Zahlen liefern wichtige Informationen zur Stadtentwicklung. So bieten diese Erkenntnisse, ob Baugebiete angenommen werden und welche Dynamik im Wohnungsbau herrscht.

Wie soll sich der Campus Im Neuenheimer Feld weiterentwickeln? Mit dieser Frage hat sich einmal mehr das Forum Masterplan Neuenheimer Feld befasst. Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, ist die zweitägige Sitzung zu Ende gegangen. Rund 50 Forumsmitglieder haben sich hier intensiv mit den beiden Entwicklungsentwürfen der Büros Astoc und Höger befasst und eine Reihe von Aspekten diskutiert, von Städtebau über Freiräume bis Verkehr. Rund 25 Gäste haben als Zuhörerinnen und Zuhörer vor Ort oder online die Sitzung verfolgt.
Im Einzelnen befassten sich die Forumsmitglieder unter anderem mit der Struktur der öffentlichen Räume, der Bildung von städtebaulichen Clustern, der Nachverdichtung im Bestand, der Aufenthaltsqualität im Freien, dem Erhalt des Baumbestands oder dem Wohnungsangebot. Wichtiges Thema war auch die verkehrliche Erschließung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten die unterschiedlichen Bedürfnisse der Arbeitnehmer, Studierenden, Patienten und Besucher, das Zusammenspiel von innerer und äußerer Erschließung, die Straßenbahnanbindung mit nördlicher Erschließungsstraße, Erfordernisse der Logistik oder die Parkplatzanzahl und deren Orte.
Für die Gruppe der Experten brachte Professor Rudolf Scheuvens von der TU Wien eine Analyse ein. Er plädierte für eine Synthese der guten funktionsgerechten Vorschläge aus beiden Entwürfen: So könnten gute Lösungen des Büros Höger (Beispiel: Verkehr) mit guten Lösungen des Büros Astoc (Beispiel: Quartiere) kombiniert werden. Er betonte auch, dass an mehreren Punkten noch weitergearbeitet werden müsse, unter anderem am öffentlichen Raum oder der Lage der Entwicklungsflächen der Klinik.
Die Forumssitzung war das fünfte und letzte Format der Öffentlichkeitsbeteiligung in der aktuellen Phase des Masterplanverfahrens. Zuvor hatten bereits eine öffentliche Veranstaltung, eine Ausstellung sowie eine Online-Beteiligung stattgefunden. Über 3.200 Besucherinnen und Besucher nutzten das Online-Angebot und brachten insgesamt 186 Beiträge zu den beiden Entwürfen ein. Darüber hinaus gab es ein gemeinsames Stadtteilgespräch mit insgesamt rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Stadtteilen Bergheim, Handschuhsheim, Neuenheim und Wieblingen.
Wie geht es weiter?
Alle Eingaben und Einschätzungen aus den verschiedenen Beteiligungsformaten werden nun dokumentiert, gesammelt betrachtet und durch die Projektträger zu einer Beschlussvorlage entwickelt. Ab dem Jahreswechsel 2021/22 wird in den Bezirksbeiräten und Ausschüssen über die Entwicklungsentwürfe und das weitere Vorgehen beraten. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 soll dann der Gemeinderat entscheiden.
Ergänzend: Die gemeinsame Empfehlung der Experten und lokalen Fachvertreter sowie weitere Materialien sind auf www.masterplan-neuenheimer-feld.de unter „Informieren“ > Downloads zu finden
Presseinformation der Stadt Heidelberg vom 14.10.2021